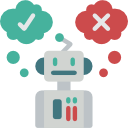Ethische Herausforderungen bei KI-Entscheidungsfindung
Die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz hat neue Möglichkeiten, aber auch komplexe ethische Fragestellungen geschaffen. KI-Systeme übernehmen immer häufiger Entscheidungen, die früher Menschen vorbehalten waren – von automatisierten Diagnosen in der Medizin bis hin zu Kreditvergaben oder selbstfahrenden Fahrzeugen. Dieser Fortschritt bringt nicht nur technische, sondern vor allem ethische Herausforderungen mit sich. Es stellt sich die Frage, wie Algorithmen fair, transparent und nachvollziehbar handeln können, ohne bestehende gesellschaftliche Ungleichheiten zu verstärken oder neue Risiken zu schaffen. Im Folgenden werden zentrale ethische Herausforderungen bei der KI-Entscheidungsfindung beleuchtet und deren Auswirkungen sowie Lösungsansätze diskutiert.
Die Black Box Problematik
Anforderungen an die Offenlegung von Entscheidungswegen
Vertrauensaufbau durch erklärbare KI
Fairness und Diskriminierung